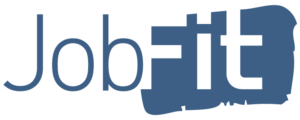Sprache als Brücke – Dos and Don’ts im Dialog mit Geflüchteten
Anhelina Savenko — Studentin des Studiengangs Health Communication an der Universität Bielefeld & Praktikantin in der Arbeitsmarktintegrativen gesundheitsförderung

29.08.2025
Geflüchtete verlassen ihre Heimat infolge existenzieller Bedrohungen wie Verfolgung, Vertreibung oder bewaffneter Konflikte. Traumatische Erfahrungen vor, während und nach der Flucht sowie belastende Lebensbedingungen im Aufnahmeland führen häufig zu erheblichen psychischen Belastungen¹. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 ist die Zahl ukrainischer Staatsangehöriger in Deutschland von rund 151.000 auf über 1,2 Millionen im Jahr 2025 gestiegen². Die Mehrheit sind Frauen, oftmals allein mit Kindern eingereist, da wehrpflichtige Männer nicht ausreisen dürfen³. Diese Gruppe gilt als besonders vulnerabel, da sie neben der Bewältigung von Flucht- und Kriegserfahrungen mit eingeschränktem Arbeitsmarktzugang, Sprachbarrieren, fehlender Kinderbetreuung und psychischer Belastung konfrontiert ist³.
Warum sprechen Menschen miteinander?
Menschen führen Gespräche aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, um praktische Informationen, Unterstützung oder Ressourcen zu erhalten, die bei der Lösung aktueller Probleme helfen⁴. Zweitens, um emotionale Stabilität zu erlangen – indem man verstanden wird, Gefühle ausdrückt und so innere Anspannung abbaut. Drittens, um Erfahrungen und Veränderungen zu reflektieren und daraus Entscheidungen für die Zukunft abzuleiten. In der Realität durchlaufen erfolgreiche Gespräche meist alle drei Phasen. Besonders im Kontakt mit Geflüchteten, die oft unter Belastungen und traumatischen Erfahrungen leiden, ist es entscheidend, Gespräche sensibel zu gestalten und dabei eine klare Struktur zu nutzen.
Man sollte mit Geflüchteten nicht automatisch so sprechen, als handele es sich ausschließlich um Opfer, da Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kontexten kommen und sehr verschiedene Erfahrungen gemacht haben – einige haben weder Bomben gehört noch in Schutzräumen gesessen, während andere gravierende traumatische Ereignisse wie Gewalt, den Verlust nahestehender Personen oder andere einschneidende Erfahrungen erlebten; um angemessen und respektvoll zu kommunizieren, ist daher ein grundlegendes Wissen über die jeweilige Herkunftsregion und die spezifische Situation im Herkunftsland hilfreich.
Wie spreche ich am besten? – Gesprächsalgorithmus⁴
Zu Beginn empfiehlt sich ein klar strukturierter Ablauf, der Sicherheit schafft und Vertrauen aufbaut:
- Über sich selbst sprechen – Den eigenen Namen, die aktuelle Rolle oder Funktion sowie den zeitlichen Rahmen des Gesprächs nennen. Dies schafft Transparenz und reduziert Unsicherheit.
- Nach dem Zustand fragen – Offen nach dem aktuellen Befinden und der momentanen Lebenssituation erkundigen.
- Emotionen ansprechen – Raum geben, damit die Person Gefühle ausdrücken kann, und empathisch reagieren.
- Gedanken und Perspektiven – Sich für die Sichtweise, Bewertungen und möglichen Pläne der Person interessieren, ohne zu drängen.
Do’s – Was soll und darf man fragen⁴ ⁵
- Sicherheit und Rahmen klären – Gleich zu Beginn erklären, wer man ist, wie lange man Zeit hat, und was im Gespräch möglich ist.
- Offen und neugierig sein – Offene Fragen stellen, die Raum für individuelle Antworten lassen, z. B. „Wie war deine Ankunft hier?“:
- Nach Herkunft fragen – Region oder Stadt, bei Soldaten ggf. Einheit, aber ohne Druck.
- Nach Wohlbefinden fragen – „Fühlst du dich jetzt etwas besser?“
- Unverbindliche Themen ansprechen – Hobbys, Studium, Beruf, Alltag.
- Zukunft nur vorsichtig ansprechen – „Haben Sie schon Ideen, was Sie als Nächstes machen möchten?“
Dabei bewusst Raum lassen, denn viele neu Angekommene sehen momentan keine klare Perspektive und wissen nicht, wie sich die Situation in ihrem Heimatland entwickeln wird oder ob es überhaupt eine Möglichkeit zur Rückkehr geben kann. - Aktiv zuhören – Mehr zuhören als reden, Signale des Verstehens geben (nicken, kurze Bestätigungen).
- Angebot zur Unterstützung formulieren – „Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie das möchten.“
- Ressourcenorientiert sprechen – Stärken und kleine Fortschritte anerkennen, z. B. „Es ist beeindruckend, wie du diese Situation meisterst.“
- Gemeinsames Verständnis schaffen – Missverständnisse klären und Begriffe erklären.
Trotz aller Offenheit kann es passieren, dass unbeabsichtigt ein traumatisches Erlebnis angesprochen wird, über das die Person nicht reden möchte. In diesem Fall sollte sensibel reagiert werden, ohne Schuldzuweisungen. Hilfreich ist eine kurze Nachfrage („War das gerade unpassend?“), gefolgt von einer Entschuldigung und der Rückkehr zu einem neutraleren Gesprächsthema.⁴ ⁶
Don’ts – Was vermieden werden sollte
Beim Einstieg in das Thema Don’ts ist es hilfreich, sich einige grundlegende Gesprächsprinzipien vor Augen zu führen⁷: Im Gespräch sollte man ganz im Moment sein – nicht nur körperlich anwesend, sondern auch gedanklich aufmerksam. Wenn man etwas nicht weiß, ist es besser, dies ehrlich zuzugeben, anstatt zu spekulieren. Ebenso ist es wichtig, die eigene Erfahrung nicht mit der des Gegenübers gleichzusetzen, da jede Geschichte einzigartig ist. Und schließlich: Wirklich zuhören, ohne das Gespräch sofort mit eigenen Erzählungen oder Ratschlägen zu unterbrechen, schafft die Basis für Vertrauen und Offenheit.
- Nicht annehmen, was der andere fühlt oder braucht ⁵ – Keine vorschnellen Deutungen oder „Ich weiß, wie Sie sich fühlen“.
- Nicht drängen oder dominieren – Keine Themen aufzwingen, Gesprächsführung nicht komplett übernehmen.
- Keine direkten Fragen zu Verlusten oder Kriegsereignissen stellen (in der Bearbeitung) – z. B. „Wer aus ihrer Familie lebt noch?“ oder falls mit Militärperson „Wie war deine Zeit während des Dienstes?“. ABER: Wenn die Person offen darüber sprechen möchte, sollte man aufmerksam zuhören, echtes Interesse zeigen und den Erzählraum respektvoll halten, ohne zu unterbrechen oder zu bewerten. Manchmal teilen Menschen erschütternde Erlebnisse aus ihrem Leben und aus dem Krieg. In solchen Momenten ist es wichtig, achtsam zuzuhören – nicht aus Sensationslust, sondern um ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Geschichte gehört und gewürdigt wird. Wenn du merkst, dass du die Geschichte gerade nicht hören kannst oder möchtest, solltest du das respektvoll und ehrlich kommunizieren, ohne die Person abzuwerten. Du könntest zum Beispiel sagen: „Es tut mir leid, ich merke gerade, dass ich nicht in der richtigen Verfassung bin, um dir so zuzuhören, wie du es verdienst.“
- Sensibel bei Fluchtweg-Fragen – Die Flucht kann traumatische Erlebnisse enthalten; vermeiden Sie direkte Nachfragen.
- Nicht nach sozialem Status vor der Flucht fragen – z. B. „Waren Sie reich oder arm?“ kann verletzend wirken, da manche vor dem Krieg ein gesichertes Leben mit Haus, Auto und Reisen hatten – und dennoch durch den Krieg alles verloren haben.
- Keine Bagatellisierung oder Dramatisierung – Sätze wie „Das wird schon“ oder übertriebenes Mitleid vermeiden.
- Keine schnellen Ratschläge geben⁵ – Erst zuhören, dann gemeinsam Lösungen entwickeln.
- Nicht kulturelle Unterschiede ignorieren – Vermeiden Sie Pauschalisierungen wie „Das ist hier anders, so macht man das“.
- Bestimmte Floskeln sollten im Gespräch mit geflüchteten Personen, die ihre Angehörigen verloren haben, unbedingt vermieden werden – insbesondere, wenn dieser Verlust im Gespräch deutlich wird⁸:
- „Sie müssen Ihr Leben weiterleben.“
- „Sie sind noch jung, Sie werden schon wieder jemanden finden.“
- „Sie müssen doch noch Kinder bekommen.“
- „Das Universum ist ungerecht – die Besten müssen zuerst gehen.“
- „Sie müssen loslassen.“
- „Trauern Sie nicht der Vergangenheit nach.“
- „Anderen geht es viel schlechter – sie haben ganze Familien verloren.“
- „Sie müssen stark sein.“
- „Halten Sie durch – Ihrer Familie zuliebe.“
- „Halten Sie durch – die Zeit heilt alle Wunden.“
- „Jetzt ist Krieg – jeder verliert jemanden.“
- Nicht ungefragt in der Sprache des Konfliktgegners sprechen⁹ – Sprache kann stark mit traumatischen Erlebnissen verknüpft sein.
- Negativbeispiel: „Ich kenne ein paar Wörter auf Russisch, die Sprache ist ja ähnlich.“
- Positivbeispiel: Vorher fragen: „Sprechen Sie diese Sprache oder ist es unangenehm?“
- Keine „Medienwahrheitsfragen“ provokativ stellen⁹ – Der Krieg ist Realität, was den Geflüchteten persönlich betrifft und nicht nur ein Diskussionsthema.
- Negativbeispiel: „Geht es im Krieg nicht eigentlich nur ums Geld und nicht um Menschenleben?“
- Positivbeispiel: Interesse zeigen: „Können Sie mir von Ihrer Region erzählen?“/ Falls es für Sie in Ordnung ist – „wie geht es Ihrer Familie?“ / „Können Sie mir ein ukrainisches Gericht zeigen?“
Fazit
Jede Geschichte ist einzigartig und enthält sowohl schmerzhafte als auch überraschend positive Erfahrungen. Ich bin 2022 nach Deutschland gekommen und habe den Flüchtlingsstatus erhalten. Das klingt für viele dramatisch, doch ich sehe mich nicht nur als jemand, der flieht, sondern als jemand, der seinen Weg weitergeht. In der europäischen Kultur habe ich erlebt, dass sensible Themen oft mit großer Vorsicht behandelt oder gar nicht angesprochen werden. Das ist einerseits respektvoll, andererseits wünsche ich mir manchmal einfach jemanden, der zuhört – ohne Angst vor den „falschen“ Fragen.
Es gibt Momente, in denen man sich zwischen den Welten fühlt – weder ganz hier noch ganz dort. Man sucht seinen Platz, lernt, die Tage in der neuen Umgebung zu gestalten, und bleibt dennoch mit der eigenen Vergangenheit verbunden.
Ich bin Ukrainerin, und ich bereue diesen Teil meiner Identität nicht – im Gegenteil. Wie jeder Mensch habe ich Potenzial, und ich will es nutzen, um anderen zu helfen. Ich bin offen für Fragen und werde Antworten finden, auch wenn manches schmerzt. Ich kämpfe nicht nur gegen Vorurteile und Missverständnisse, sondern auch für meine Freiheit – die Freiheit, mich in einer Gesellschaft verstanden zu fühlen und die Gesellschaft selbst zu verstehen.
Ich bin bereit, Neues zu lernen – Kultur, Sprache, Perspektiven – und gleichzeitig meine eigene Kultur, Sprache und Erfahrungen zu teilen. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern Gestalterin meiner Zukunft.
- Nesterko, Y., Brunner, J., Glaesmer, H. (2024). Psychische Gesundheit. Traumatische Belastungen von Geflüchteten und deren Versorgung. In: Werner, F., Piechura, P., Bormann, C., Breckner, I. (eds) Flucht, Raum, Forschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978–3‑658–43707-7_17
- Mediendienst Integration. (2025, März). Ukrainische Flüchtlinge: Zahlen für Deutschland & Europa. Abgerufen am 12. August 2025, von https://mediendienst-integration.de/artikel/Ukrainische-Fluechtlinge-Zahlen-fuer-Deutschland-Europa.html
- Statistisches Bundesamt [Destatis]. (o. J.). Im Fokus: Russland und Ukraine. Abgerufen am 12. August 2025, von https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/ukraine.html
- Medynska, O., & Team „Поговори зі мною“. (2023). Поговори зі мною: Як спілкуватися з людьми, що пережили травматичний досвід [Sprich mit mir: Wie man mit Menschen spricht, die traumatische Erfahrungen gemacht haben]. Projekt „Поговори зі мною“.
- Reichelt, S., & Sveaass, N. (1994). Therapy with refugee families: What is a “good” conversation? Family Process, 33(3), 247–262. https://doi.org/10.1111/j.1545–5300.1994.00247.x.
- Medynska, O., & Team „Як ти, брате?“. (2023). Як ти, брате? Порадник для спілкування з військовослужбовцями та ветеранами [Wie geht es dir, Bruder? Ratgeber für die Kommunikation mit Militärangehörigen und Veteranen]. Projekt „Як ти, брате?“.
- Headlee, C. (2015, May). 10 ways to have a better conversation [Video]. TED Conferences. https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation
- Semenov, A. (2024). Wie geht es dir… Wie man mit Menschen spricht, die ihre Angehörigen verloren haben (7. Aufl.). Projekt „Wie geht es dir, Bruder?“. https://yakty.com.ua (S. 17–18: „Verbotene Phrasen“)
- Strelchenko, A. (2024, April 25). Five things not to say to Ukrainians. The Bagpipe. Abgerufen am 8. August 2025, von https://www.bagpipeonline.com/opinions/2024/4/24/five-things-not-to-say-to-ukrainians
Falls Sie die Nachrichten aus ukrainischen Medien verfolgen möchten, finden Sie hier einige unabhängige Medien, die auf Englisch berichten bzw. senden (Hinweis: Externe Links):